Suchergebnisse für "blickbezuege-eis-und-schwimmstadion-lentpark-in-koeln-11348"
- Alternative Suchbegriffe
- blickbezuege eis und schwimmstadion lentpark in kreon 11348
- blickbezuge eis und schwimmstadion lentpark in koeln 11348
-
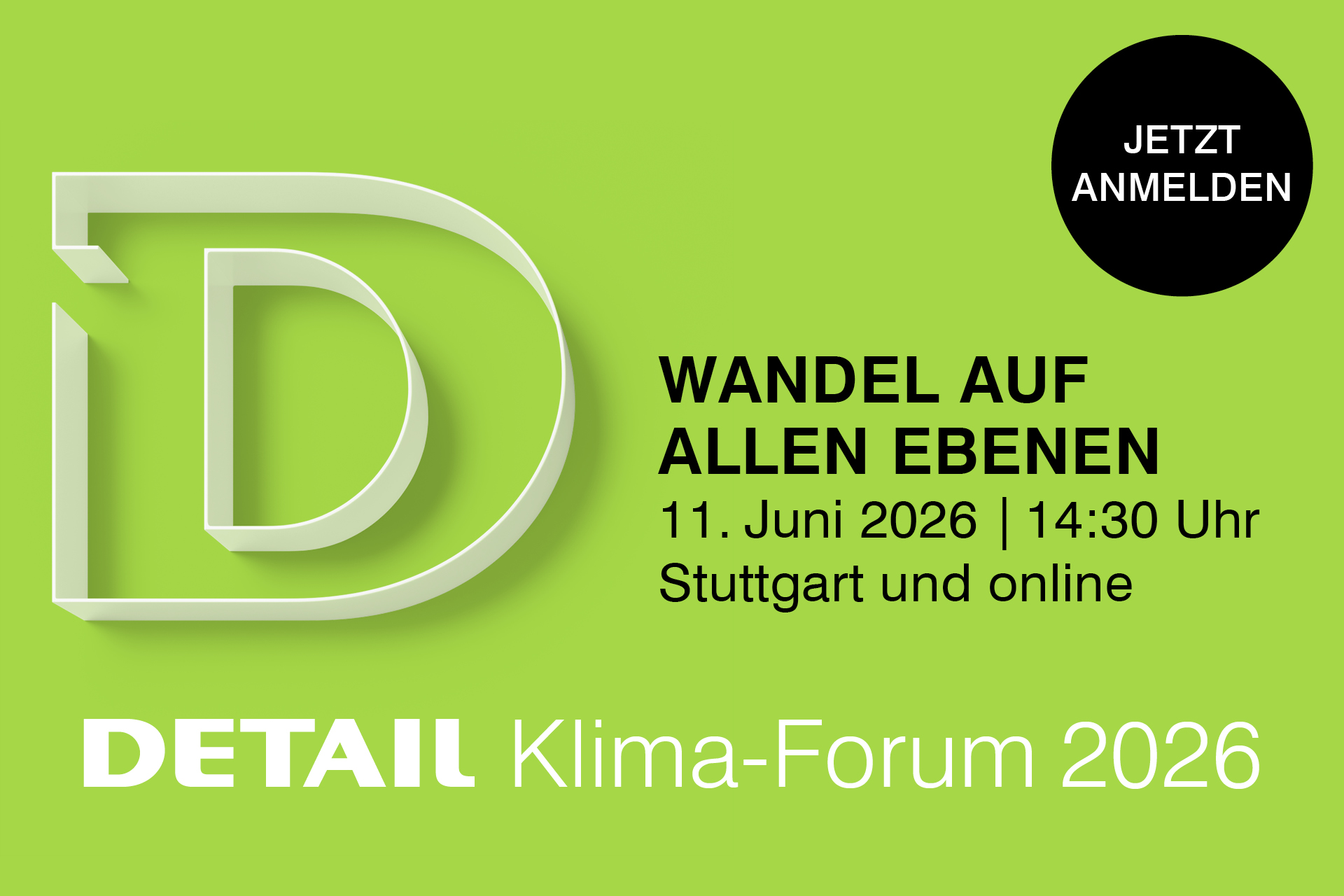
DETAIL Klima-Forum
DETAIL Klima-Forum 2026Beim DETAIL Klima-Forum 2026 geht um Bauen mit Bestand und Bauen mit Beständigkeit mit dem Ziel, den branchenspezifischen Diskurs zu diesen Themen anzustoßen und weiterzuentwickeln.
-

DETAIL Digital Kongress
DETAIL Digital Kongress 2026Die Digitalisierung verändert die Bauwelt – von der Planung über die Umsetzung bis zur Nutzung. Welche Chancen nutzen wir schon heute? Wo fehlt der Mut zum Experimentieren?
-

17. April 2026 I Aitrach
36. GISOTON-SeminarDas Gisoton-Seminar vereint seit 1990 Branchenexperten zu innovativen Lösungen für nachhaltiges und effzientes Bauen – mit Top-Referenten und über 300 Fachbesuchern.
-

Kunst statt Kohle
Kraftwerksumbau in Xi’an von Nomos ArchitectsIn ein ehemaliges Kohleheizkraftwerk integrierte das Architekturbüro Nomos eine Ausstellungshalle für Kunst. Eine Polycarbonatfassade lässt gefiltertes Tageslicht ins Innere.
-

29.11.25 - 12.04.26 I Karlsruhe
Archistories. Architektur in der KunstDie Sonderausstellung „Archistories. Architektur in der Kunst″ versammelt rund 100 Werke von 70 Künstler:innen aus fünf Jahrhunderten, die Gebäude und das Bauen auf unterschiedliche Weise reflektieren.
-

Ein Haus voller Geschichten
Einfamilienhaus in London von 31/44 ArchitectsIm Londoner Chrystal Palace hat Will Burges von 31/44 Architects ein Wohnhaus für sich und seine vierköpfige Familie realisiert, das Wissen und Erinnerungen in einem kompakten Baukörper speichert.
-

DETAIL Leserfavoriten 2025
Ihre Interiors & Design-Highlights des JahresZum Jahresende präsentieren wir die drei beliebtesten Beiträge aus der Kategorie Interiors & Design: Zwei sensibel modernisierte Umbauten und ein Pavillon, der mit taktilen und sensorischen Raumqualitäten begeistert.
-

Ein Farbton mit Haltung
NO 65 Skater: Präziser Ton zwischen Blau und GrünNO 65 Skater von Caparol Icons legt ein leises Petrol in den Raum, eine Nuance zwischen Blau und Grün. Die Rezeptur erzeugt matte, stabile Oberflächen für glatte Wände und vielseitige Raumprogramme.
-

Advertorial
Die Rückkehr der Gebäude als atmende SystemeNeue Projekte in China setzen auf Mikroklimata, offene Strukturen und integrierte Systeme – und formulieren damit eine zeitgemäße Haltung im nachhaltigen Bauen.
-

Pragmatismus bis ins Detail
Künstleratelier im Sitterwerk von Flury + Furrer2023 wurde im Sitterwerk ein neues Atelier für den Künster Jim Dine errichtet. Die Architektur verbindet Purismus, Pragmatismus, die Gestaltung von Alt und Neu sowie den Wunsch, Teil von einer Atmosphäre bleiben zu können.
-

Advertorial
AEC neu denken: Mit KI von der Idee zur UmsetzungMarco Iannelli setzte Veras ein, um komplexe Konzepte für die Penthouse-Erweiterung in schnelle, visuelle Design-Iterationen zu übersetzen und Entscheidungen einfacher zu machen.
-

Viel Raum für wenig Geld
Wohnhauserweiterung in Aachen von Aretz DürrIn Aachen wollte ein Ehepaar kurz vor dem Ruhestand seine Doppelhaushälfte erweitern. Das Team von Aretz Dürr entwarf einen schlanken Holzbau mit Hülle aus Glas und Wellblech, der auch für die Zukunft viele Nutzungsoptionen offenhält.
-

Neue L-Form
Flacher Türdrücker zeigt klare GeometrieDer Edelstahl-Drücker D-360 interpretiert die L-Form als flache, rechtwinklige Linie. Breite Handauflage, präzise Kanten und Gleitlagertechnik der Klasse 4 nach EN 1906 sichern robuste Nutzung im Objektbereich.
-

Advertorial
Die mobile ImmobilieFlexible Büro- und Eventgebäude in Modulbauweise: Maßgeschneiderte Räume, energieeffizient, nachhaltig und schlüsselfertig – die perfekte Lösung für Ihr Unternehmen.



